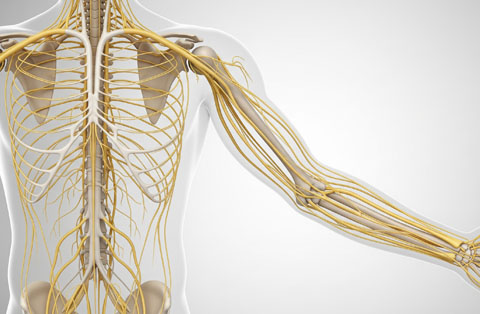Kämpfen Sie mit trockenen, gereizten Augen? Erfahren Sie, was das Sicca-Syndrom verursacht, und entdecken Sie bewährte Behandlungen, um Symptome zu lindern, Ihre Sehkraft zu schützen und langfristigen Augenkomfort wiederherzustellen.
Das Sicca-Syndrom ist eine häufige Erkrankung, bei der Ihre Augen nicht genug Tränen produzieren oder die Tränen zu schnell verdunsten. Das führt zu Reizung, verschwommenem Sehen und Unbehagen.
Sie betrifft Millionen Menschen weltweit, insbesondere Erwachsene über 50 und Personen, die viele Stunden vor Bildschirmen verbringen. Unbehandelt kann Trockenheit den Alltag beeinträchtigen und sogar die Augenoberfläche schädigen.
In diesem Leitfaden erfahren Sie, was trockene Augen verursacht, wie Sie die Symptome erkennen und welche Behandlungen am wirksamsten sind – für langfristige Linderung und gesündere Augen.
Was ist das Syndrom des trockenen Auges?
Das Sicca-Syndrom ist eine Erkrankung, bei der die Augen nicht genügend Tränen produzieren oder die Tränen zu schnell verdunsten. Infolgedessen wird die Augenoberfläche trocken, gereizt und entzündet. Man spricht auch von „Dry-Eye-Disease“ oder Keratokonjunktivitis sicca.
Tränen sind essenziell für die Augengesundheit: Sie halten die Oberfläche glatt, spülen Partikel weg und schützen vor Infektionen. Wenn der Tränenfilm instabil oder unzureichend ist, kommt es zu Trockenheit, Beschwerden und teils verschwommenem Sehen.
Die Störung kann ein oder beide Augen betreffen. Sie reicht von gelegentlicher, milder Trockenheit bis zu einer chronischen Form mit deutlichen Alltagsbeeinträchtigungen. Obwohl sie mit dem Alter – besonders bei Frauen – häufiger wird, kann sie jeden betreffen.
Es handelt sich um eine Langzeiterkrankung. Die meisten Betroffenen kommen mit geeigneter und konsequenter Behandlung gut zurecht, doch eine frühzeitige Diagnose ist wichtig, um Komplikationen wie Hornhautschäden oder Sehverschlechterungen zu vermeiden.
Was sind die Ursachen für trockene Augen?
Trockene Augen entstehen durch Störungen des Tränenfilms, der dünnen Schicht, die die Augenoberfläche bedeckt und schützt. Er besteht aus drei Komponenten: Öl, Wasser und Schleim. Ist eine dieser Schichten gestört, verdunsten Tränen schneller oder es wird zu wenig Tränenflüssigkeit produziert.
Die Ursachen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen:
1. Verminderte Tränenproduktion (wässrig-defizitäres trockenes Auge)
Die Augen produzieren zu wenig der wässrigen Tränenkomponente. Gründe können sein:
Alterung: Die Tränenproduktion nimmt mit zunehmendem Alter natürlicherweise ab.
Hormonelle Veränderungen: besonders in den Wechseljahren oder während der Schwangerschaft.
Bestimmte Medikamente: darunter Antihistaminika, Antidepressiva, Blutdruckmittel und Diuretika.
Autoimmunerkrankungen: wie Sjögren-Syndrom, rheumatoide Arthritis oder Lupus.
Nervenschädigungen: durch Augenoperationen oder Kontaktlinsentragen, die die Funktion der Tränendrüsen beeinträchtigen können.
2. Erhöhte Tränenverdunstung (evaporatives trockenes Auge)
Die Tränen werden zwar produziert, verdunsten aber zu schnell, verursacht durch:
Meibomdrüsen-Dysfunktion (MGD): wenn die Öldrüsen in den Lidern verstopft oder entzündet sind.
Umweltfaktoren: Wind, trockene Luft, Klimaanlagen und Bildschirmarbeit verringern die Lidschlagfrequenz und erhöhen die Verdunstung.
Kontaktlinsen: können den Tränenfilm langfristig destabilisieren.
Allergien oder Augeninfektionen: entzünden die Augenoberfläche und verstärken die Trockenheit.
Manche Betroffene haben eine Mischform, bei der sowohl Produktion als auch Verdunstung beeinträchtigt sind. Die Ursache zu identifizieren, ist entscheidend für die passende Therapie.
Können Augenoperationen trockene Augen verursachen?
Ja, Augenoperationen können trockene Augen auslösen oder verstärken. Das ist ein häufiger Nebeneffekt, besonders nach Eingriffen an der Hornhaut oder Eingriffen, die den Tränenfilm stören.
Am häufigsten sind folgende Operationen beteiligt:
LASIK und PRK: Diese refraktiven Eingriffe formen die Hornhaut um und können Hornhautnerven schädigen, die die Tränenproduktion anstoßen. Häufig treten vorübergehende, teils auch länger anhaltende Beschwerden auf.
Kataraktoperation: Moderne Techniken senken das Risiko, dennoch entwickeln manche Patient innen trockene Augen durch Entzündung, Veränderungen der Augenoberfläche oder eingesetzte Medikamente. Erfahren Sie mehr über trockene Augen nach einer Katarakt-OP.
Lidoperationen (Blepharoplastik): Eingriffe an den Lidern können Lidschluss und Tränenverteilung beeinträchtigen und so Trockenheit begünstigen.
Postoperative Trockenheit bessert sich meist innerhalb weniger Monate. Vorbestehende Trockenheit oder Meibomdrüsen-Dysfunktion erhöhen jedoch das Risiko für länger anhaltende Symptome. Präoperatives Screening und gute Nachsorge sind dafür entscheidend.
Wie beeinflussen Umwelt und Lebensstil trockene Augen?
Umwelt- und Lebensstilfaktoren beeinflussen die Stabilität des Tränenfilms stark und können Symptome trockener Augen verursachen. Diese Auslöser erhöhen die Verdunstung oder verringern den Lidschlag – die Augen fühlen sich trocken, gereizt oder müde an.
Häufige Auslöser sind:
Trockene Luft: Wind, Heizung, Klimaanlage oder geringe Luftfeuchte entziehen der Augenoberfläche Feuchtigkeit.
Bildschirmarbeit: Langes Arbeiten am Computer oder Smartphone verringert die Lidschlagfrequenz – Tränen verdunsten schneller.
Luftgetragene Reizstoffe: Rauch, Staub und Schadstoffe entzünden die Augenoberfläche und destabilisieren den Tränenfilm.
Kontaktlinsen: Längeres Tragen kann den Tränenfilm stören, vor allem bei ungeeigneter Anpassung oder Pflege.
Schlafmangel: mindert die Tränenqualität und die Regeneration der Augenoberfläche.
Dehydrierung: zu wenig Flüssigkeit senkt die Tränenproduktion und verstärkt Trockenheit.
Unzureichende Lidrandhygiene: verstopfte Öldrüsen erhöhen die Verdunstung.
Maßnahmen wie Luftbefeuchter einsetzen, Bildschirmpausen einlegen und die Augen vor Wind schützen, lindern Symptome und unterstützen das Langzeitmanagement.
Welche selteneren Ursachen für trockene Augen sollten Sie kennen?
Neben Alter, Meibomdrüsen-Dysfunktion und Umweltreizen gibt es seltenere Auslöser, die zu trockenen Augen führen können. Sie werden oft übersehen, sind aber für Diagnose und Therapie wichtig.
Zu den weniger typischen Ursachen zählen:
Autoimmunerkrankungen: außer dem Sjögren-Syndrom auch Lupus, rheumatoide Arthritis oder Sklerodermie – sie können die Tränendrüsen beeinträchtigen.
Vitamin-A-Mangel: wichtig für eine gesunde Augenoberfläche; ausgeprägter Mangel kann Trockenheit und Schäden verursachen.
Schilddrüsenerkrankungen: Hyperthyreose oder Morbus Basedow verändern Lidstellung oder -funktion und erhöhen die Verdunstung.
Parkinson und andere neurologische Störungen: vermindern den Lidschlag oder die nervale Steuerung der Tränenproduktion.
Lidanomalien: Ektropium (Auswärts-) oder Entropium (Einwärtsdrehung) stören Verteilung und Abfluss der Tränen.
Graft-versus-Host-Erkrankung (GVHD): diese Immunreaktion nach Knochenmarktransplantation kann Tränengewebe schädigen.
Längerfristige Einnahme bestimmter Medikamente: Antidepressiva, Aknetherapien (z. B. Isotretinoin) und Hormontherapien können die Tränenproduktion stärker beeinflussen als erwartet.
Diese seltenen Ursachen zu erkennen, ist besonders bei hartnäckigen, therapieresistenten Beschwerden wichtig.
Was sind die Symptome des Sicca-Syndroms?
Die Symptome reichen von leichtem Unbehagen bis zu ausgeprägter Reizung, die den Alltag stört. Oft entwickeln sie sich schleichend und verschlimmern sich in bestimmten Umgebungen oder bei bestimmten Tätigkeiten.
Häufige Symptome sind:
Fremdkörper-/Sandkorngefühl: Viele beschreiben das Gefühl, als sei etwas im Auge.
Brennen oder Stechen: Die unzureichend befeuchtete Oberfläche entzündet sich.
Rötung: Anhaltende Trockenheit führt zu sichtbarer Gefäßerweiterung.
Verschwommenes oder schwankendes Sehen: bessert sich oft nach dem Blinzeln, besonders beim Lesen oder bei Bildschirmarbeit.
Lichtempfindlichkeit (Photophobie): die freiliegende, trockene Oberfläche reagiert empfindlicher auf Licht.
Übermäßiges Tränen: Paradoxerweise produzieren sehr trockene Augen Reflextränen, die die Oberfläche nicht richtig benetzen.
Augenmüdigkeit: langes Fokussieren ohne ausreichendes Blinzeln (z. B. bei Bildschirmzeit) verschlimmert die Beschwerden.
Unverträglichkeit von Kontaktlinsen: Trockenheit reduziert die Linsentoleranz und erhöht die Reibung.
Meist sind beide Augen betroffen, eines oft stärker. Die Symptome schwanken im Tagesverlauf und verschlechtern sich häufig abends oder nach Tätigkeiten mit langer visueller Konzentration. Anhaltende Beschwerden sollten augenärztlich abgeklärt werden.
Wie wird trockenes Auge diagnostiziert?
Die Diagnose basiert auf den geschilderten Beschwerden und klinischen Tests, die Qualität und Menge der Tränen sowie die Augenoberfläche beurteilen. Dabei werden Anamnese und Untersuchung kombiniert, um trockene Augen von anderen Augenerkrankungen abzugrenzen.
Wesentliche Schritte der Diagnostik:
Symptombewertung: Art, Häufigkeit und Schweregrad der Beschwerden werden erfragt. Standardisierte Fragebögen wie der Ocular Surface Disease Index (OSDI) quantifizieren die Belastung.
Beurteilung des Tränenfilms:
Tränenfilm-Aufrisszeit (TBUT): Mit einem Farbstoff wird gemessen, wie lange der Film stabil bleibt. Kurze Zeiten sprechen für Instabilität.
Schirmer-Test: misst die Tränenproduktion mittels Papierstreifen im Unterlid. Geringe Befeuchtung zeigt ein vermindertes Tränenvolumen an.
Tränenosmolarität: ermittelt die Salzkonzentration der Tränen; hohe Werte deuten auf ein Ungleichgewicht hin.
Färbungen der Augenoberfläche: Fluoreszein, Lissamingrün oder Rose-Bengal heben trockene oder geschädigte Areale hervor.
Bewertung der Meibomdrüsen: Untersuchung der Lidranddrüsen zum Nachweis einer Meibomdrüsen-Dysfunktion (häufige Ursache des evaporativen trockenen Auges).
Lidschlag und Lidschluss: unvollständiges Blinzeln oder unzureichender Lidschluss können auffallen.
Eine präzise Diagnose ist wichtig, da Symptome nicht immer mit dem Schweregrad der Oberflächenschädigung korrelieren. Frühzeitiges Erkennen beugt Spätfolgen vor.
Welche Behandlungen gibt es?
Ziele der Therapie sind die Wiederherstellung des Tränenfilm-Gleichgewichts, Symptomlinderung und der Schutz der Augenoberfläche. Die passende Behandlung richtet sich nach Ursache und Schweregrad. Häufig ist ein stufenweises Konzept mit mehreren Maßnahmen sinnvoll.
Häufig eingesetzte Therapien:
Künstliche Tränen: frei verkäufliche, befeuchtende Tropfen ergänzen die natürlichen Tränen. Für häufigen Gebrauch sind konservierungsmittelfreie Präparate besser verträglich.
Verschreibungspflichtige Augentropfen:
Ciclosporin (z. B. Restasis®) und Lifitegrast (z. B. Xiidra®) reduzieren Entzündungen und fördern die Tränenproduktion.
Topische Kortikosteroide können kurzfristig bei starker Entzündung eingesetzt werden.
Punktum-Plugs: winzige Stöpsel in den Tränenabflusskanälchen, die den Abfluss verlangsamen und Tränen länger am Auge halten.
Therapie der Meibomdrüsen: bei evaporativer Form helfen Wärmeverfahren wie LipiFlow®, manuelle Expression oder IPL (Intense Pulsed Light), die Drüsen zu öffnen.
Autologe Serumtropfen: bei schweren Verläufen fördern aus eigenem Blut gewonnene Tropfen die Heilung der Oberfläche.
Orale Medikamente: niedrig dosierte Antibiotika wie Doxycyclin bei entzündlicher Komponente bzw. MGD.
Lidrandhygiene und warme Kompressen: tägliche Reinigung und Wärme verbessern die Drüsenfunktion und lindern Reizungen.
Umwelt-/Lebensstil-Anpassungen: Luftbefeuchter nutzen, Bildschirmzeit reduzieren, ausreichend trinken sowie Schutz vor Wind/Rauch unterstützen die Therapie.
Eine Universallösung gibt es nicht. Oft sind fortlaufende Betreuung und Anpassungen nötig. Eine frühe, individuell abgestimmte Therapie senkt das Risiko für Hornhautschäden und verbessert die Lebensqualität.
Was, wenn invasivere Maßnahmen nötig sind?
Wenn Standardtherapien wie künstliche Tränen und verordnete Tropfen die Symptome nicht ausreichend kontrollieren, kommen fortgeschrittene oder invasive Optionen in Betracht – vor allem bei mittel- bis schweren Formen mit Oberflächenschädigung oder erheblicher Alltagsbeeinträchtigung.
Invasive und fortgeschrittene Behandlungen:
Punktum-Okklusion:
Die Tränenabflusskanälchen (Puncta) werden blockiert, um Feuchtigkeit länger am Auge zu halten – vorübergehend mit resorbierbaren Plugs oder dauerhaft per Kauterisation.Amnionmembran-Therapie:
Eine Amnionmembran (aus gespendetem Plazentagewebe) kann bei schweren Fällen auf das Auge gelegt werden, um Heilung zu fördern und Entzündung zu senken.Autologe Serumtropfen:
Aus dem eigenen Blut gewonnen; enthalten Wachstumsfaktoren und Nährstoffe ähnlich den natürlichen Tränen – bei starker Trockenheit/Schädigung der Oberfläche.Tarsorrhaphie:
Chirurgisches teilweises Verschließen der Lider zur Verringerung der Verdunstung – reserviert für schwerste, therapierefraktäre Fälle.Sklerallinsen:
Großlinsen, die die Hornhaut überdecken und eine Flüssigkeitsschicht am Auge halten – für anhaltende Befeuchtung und Schutz, häufig bei fortgeschrittenem trockenem Auge oder Hornhauterkrankungen.Chirurgische Korrektur von Lidfehlstellungen:
Bei Ektropium/Entropium kann eine Operation nötig sein, um Funktion und Tränenverteilung zu normalisieren.
Diese Therapien werden in der Regel von Spezialist innen für Augenoberflächenerkrankungen verordnet und überwacht. Bei schweren oder therapieresistenten Verläufen können sie spürbare Linderung bringen und sehbedrohliche Komplikationen verhindern.
Wie behandeln und managen Sie trockene Augen langfristig?
Die Langzeitstrategie zielt auf einen stabilen Tränenfilm, Entzündungskontrolle und das Verhindern von Schüben. Da das Sicca-Syndrom oft chronisch ist, führt konsequente Pflege eher zum Erfolg als eine einmalige Maßnahme.
Wichtige Strategien für die Langzeitbehandlung:
Tägliche Anwendung künstlicher Tränen: konservierungsmittelfreie Tropfen regelmäßig nutzen – nicht nur bei akuten Beschwerden. Das schützt die Oberfläche und mindert Reizungen.
Lidrandhygiene-Routinen: Lidkanten mit mildem Reiniger oder speziellen Tüchern säubern. Warme Kompressen unterstützen die Meibomdrüsen und lösen Verstopfungen.
Umweltkontrolle:
Zu Hause einen Luftbefeuchter einsetzen – besonders in Heiz- oder Klimazeiten.
Direkte Luftströme (Ventilator, Autoluftdüsen) vermeiden.
In trockener, windiger Umgebung Schutzbrillen (Moisture-Chamber) tragen.
Bildschirmgewohnheiten:
20-20-20-Regel: alle 20 Minuten 20 Sekunden auf etwas in 20 Fuß (6 Meter) Entfernung blicken.
Beim digitalen Arbeiten bewusst und vollständig blinzeln.
Hydrierung und Ernährung: ausreichend trinken und Omega-3-reiche Lebensmittel (Fisch, Leinsamen, Walnüsse) einbauen; ggf. supplementieren.
Begleiterkrankungen managen: MGD, Allergien oder Autoimmunerkrankungen gezielt behandeln – das ist zentral für die Kontrolle trockener Augen.
Medikamente prüfen: gemeinsam mit der Ärztin/dem Arzt Therapien anpassen, die Trockenheit verschlimmern können (Antihistaminika, Antidepressiva, Antihypertensiva).
Regelmäßige Kontrollen: Verlaufsuntersuchungen ermöglichen Therapieanpassungen und beugen Komplikationen vor.
Langfristiges Management bedeutet einen persönlichen, proaktiven Pflegeplan. Konsequenz ist entscheidend: Selbst milde Symptome können ohne Aufmerksamkeit fortschreiten. Erfahren Sie mehr über Selbstpflege beim Sicca-Syndrom.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Sicca-Syndrom chronisch oder heilbar?
Meist ist es chronisch und nicht vollständig heilbar. Mit konsequenter Behandlung lässt es sich jedoch gut kontrollieren. Viele Betroffene lindern Beschwerden mit künstlichen Tränen, Medikamenten und Lebensstilanpassungen. Frühe Diagnose und regelmäßige Betreuung beugen Komplikationen vor und verbessern den langfristigen Komfort.
Was erwartet Sie, wenn die Symptome anhalten?
Ohne Behandlung kann es zu chronischem Unbehagen, verschwommenem Sehen und Entzündung kommen. In schweren Fällen drohen Hornhautschäden mit erhöhtem Risiko für Infektionen oder Narben. Langanhaltende Beschwerden beeinträchtigen Tätigkeiten wie Lesen, Autofahren oder Bildschirmarbeit.
Wie verhindert frühe Behandlung Komplikationen?
Frühe Therapie stabilisiert den Tränenfilm, senkt Entzündung und schützt die Oberfläche. So werden Spätfolgen wie Hornhautschäden, Sehprobleme oder chronische Reizung vermieden. Ein rechtzeitiger Beginn verbessert die Symptomkontrolle und verringert den Bedarf an invasiveren Maßnahmen.
Können Kontaktlinsen trockene Augen verursachen?
Ja, Kontaktlinsen können trockene Augen auslösen oder verschlimmern. Sie können den Tränenfilm stören, die Sauerstoffversorgung der Hornhaut reduzieren und die Verdunstung erhöhen. Langes Tragen oder schlecht sitzende Linsen steigern das Risiko. Tageslinsen oder Benetzungstropfen können helfen.
Können trockene Augen zur Erblindung führen?
Trockene Augen verursachen selten Erblindung, unbehandelt kann es jedoch zu ernsten Komplikationen kommen. Chronische Trockenheit schädigt die Hornhaut und erhöht das Risiko für Ulzera, Narben oder Infektionen – mit möglicher dauerhafter Sehbeeinträchtigung. Frühe Diagnose und richtige Behandlung schützen die Augengesundheit.
Verursachen trockene Augen Kopfschmerzen?
Trockene Augen verursachen nicht direkt Kopfschmerzen, können aber dazu beitragen. Visuelle Ermüdung durch verschwommenes Sehen, Lichtempfindlichkeit oder lange Bildschirmzeit kann Spannungskopfschmerzen auslösen. Die Behandlung der Trockenheit senkt das Risiko.
Wie ist das Sicca-Syndrom in der Schwangerschaft?
In der Schwangerschaft ist es häufig – hormonelle Veränderungen beeinflussen Produktion und Qualität der Tränen. Symptome sind u. a. Brennen, Trockenheit oder verschwommenes Sehen. Meist ist es mild und vorübergehend. Konservierungsmittelfreie Tränen sind in der Regel sicher; dennoch ärztlich abklären.
Verursachen trockene Augen „Floaters“?
Trockene Augen verursachen keine Glaskörpertrübungen (Mouches volantes). Diese kleinen Schatten im Sichtfeld entstehen durch Veränderungen des Glaskörpergels im Auge. Trockene Augen betreffen die Oberfläche, nicht die inneren Strukturen. Beide Zustände können jedoch gleichzeitig auftreten, besonders im Alter. Erfahren Sie mehr über trockene Augen und Glaskörpertrübungen.
Können trockene Augen verschwommenes Sehen verursachen?
Ja, trockene Augen können die Sicht verschleiern. Ein instabiler oder unzureichender Tränenfilm beeinträchtigt die Lichtfokussierung auf der Oberfläche und führt zu schwankender oder verschwommener Sicht. Häufiges Blinzeln oder künstliche Tränen klären meist die Sicht. Anhaltende Unschärfe weist auf eine moderate bis schwere Form hin. Erfahren Sie mehr über trockene Augen und verschwommenes Sehen.
Geht trockenes Auge jemals ganz weg?
Bei vorübergehenden Auslösern wie zu viel Bildschirmzeit, trockener Umgebung oder bestimmten Medikamenten kann es sich zurückbilden. In den meisten Fällen, besonders mit zunehmendem Alter oder bei chronischen Erkrankungen, verschwindet es nicht vollständig, lässt sich aber effektiv managen. Konsequent angewandte Therapie schützt langfristig die Augengesundheit.
Verursachen trockene Augen Rötung?
Ja, trockene Augen führen häufig zu Rötung. Fehlt der Oberfläche Feuchtigkeit, wird sie gereizt und entzündet; sichtbare Gefäße weiten sich. Rötung verstärkt sich bei Bildschirmarbeit, Wind oder anhaltender Trockenheit. Die Behandlung der Ursache reduziert in der Regel die Rötung und steigert den Komfort.